| Einführung:
In der Naturheilkunde oder -
vielleicht besser - in der bio-logischen Medizin hat man in den
letzten Jahren verstärkt nach Möglichkeiten gesucht, die
Reaktionsweise des Körpers auf verschiedene Substanzen, Emotionen,
ja generell alle möglichen Stressfaktoren zu untersuchen.
Zu diesen Methoden gehören:
Kirlianfotographie, Decoder-Dermographie, Regulationsthermographie,
Elektroakupunktur nach Voll (EAV) und die verwandten Methoden BFD
und VEGA und anderes mehr.
 |
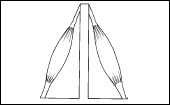 |
| |
| Wenn die Muskulatur
in Balance ist, befindet sich auch die Struktur in
Balance |
|
| |
|
| |
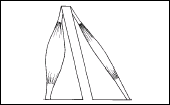 |
| |
| Bei Dysbalance der
Muskulatur kann die Struktur nicht im Gleichgewicht gehalten
werden |
|
Neben diesen Verfahren, die alle mit
Maschinen zu tun haben, gibt es aber auch Methoden, die mit sehr
einfachen Mitteln, teilweise nur mit den Händen durchführbar sind.
Die ältesten dieser Methoden sind das Pendeln und das Rutengehen. In
den letzten Jahrzehnten wurden zwei weitere faszinierende Methoden
dazu entdeckt, nämlich die sogenannte RAC-Testung nach Dr. Nogiér
(in Verbindung mit der Ohrakupunktur) sowie die Applied Kinesiology
(AK), die mit Hilfe standardisierter Tests für einzelne Muskeln des
Körpers bzw. besser durch die Diagnose der Stärkeänderung dieser
Muskeln messen kann, wie die Reaktion des Körpers auf Reize,
Substanzen und auch Emotionen jeglicher Art ist.
Wichtig ist, daß man die AK nicht im
strengen Gegensatz zu den eingeführten und bewährten
schulmedizinischen Diagnoseverfahren wie z.B. Elektrokardiographie
(EKG), Elektroenzephalographie (EEG), Labortest usw. sieht, sondern
als dringend notwendige Ergänzung. Nachfolgend sollen die Grundzüge
der Applied Kinesiology (AK) dargelegt werden.
Vor ca. 30 Jahren fand der
amerikanische Chiropraktiker George Goodheart D.C. durch Zufall bei
einem Patienten heraus, daß sich die Stärke eines Muskels sofort
verändert, wenn therapeutisch relevante Punkte am Körper des
Patienten behandelt oder auch nur berührt werden. Im Laufe der Zeit
zeigte sich, daß sich der Tonus (Anspannungszustand) von Muskeln bei
einer Vielzahl von Testexpositionen ändern kann, und zwar sowohl von
schwach nach stark als auch von stark nach schwach.
In den letzten Jahren wurde
zusätzlich eine weitere Reaktionsmöglichkeit beschrieben, nämlich
die übermäßige Stärkezunahme im Sinn eines Hypertonus - einer
"Verkrampfung" - der Muskulatur. Wie weiter unten noch ausgeführt
wird, handelt es sich hierbei um die extreme Stressreaktion der
Muskulatur als Zeichen einer maximalen Anspannung.
Prinzipiell fand Goodheart heraus,
daß man mit dem Muskeltest eine funktionelle diagnostische Aussage
darüber machen kann, wie der Körper des Patienten sowohl auf
möglicherweise positive Dinge (Heilmittel, Medikamente, manuelle
Behandlung, Akupunktur), aber auch negative Belastungen (Allergene,
unverträgliche und toxische Substanzen, negative Emotionen,
Fehlhaltung, Kiefergelenksstörungen u.a.m.) reagiert.
Bei Goodhearts erstem Patienten
handelte es sich um einen 24jährigen Mann, der lediglich ein
gesundheitliches Problem zu haben schien: Das rechte Schulterblatt
stand weit vom Körper ab und er hatte Schwierigkeiten, den rechten
Arm zu heben und zu stabilisieren. Alle üblichen orthopädischen
Tests brachten keinerlei Ergebnis. Als Goodheart den Muskel
(M.serratus anterior) mit den Händen untersuchte, fand er an den
Ursprungsstellen des Muskels am rechten Brustkorb kleine, minimal
schmerzhafte Knötchen.
Die einzige ihm damals bekannte muskuläre Behandlungsmöglichkeit war
die Massage dieser Punkte, und interessanterweise verschwanden die
kleinen Knötchen jeweils sofort nach der Massage, einer nach dem
anderen.
Nach der Therapie stand das
Schulterblatt nicht mehr vom Körper ab und der Patient konnte den
Arm problemlos und stabil heben!
Was war geschehen?
Goodheart war offensichtlich einem
neuen Prinzip durch Zufall auf die Spur gekommen: Diese sofortige
Änderung des Muskeltonus war bis dahin in der Literatur nicht
beschrieben worden. Goodheart untersuchte in den nächsten Jahren die
meisten seiner Patienten zusätzlich zu den normalen Verfahren auch
mit der Testung verschiedener Muskeln und nannte in Zukunft die
Methode "Applied Kinesiology (AK)" Er fand im Lauf der Jahre heraus,
daß die allermeisten Muskeln bestimmten Organen,
Akupunkturmeridianen, Vitaminen, Mineralstoffen usw. zugeordnet
werden können.
Die von Goodheart und anderen Mitgliedern des ICAK (International
College of Applied Kinesiology) gefundenen Zusammenhänge zeigt die
Tabelle auf Seite 3.
Die AK ist besonders geeignet zur
Diagnose aller Beschwerden, die im weitesten Sinne mit dem
Bewegungsapparat zu tun haben, da sie ja aus der Chiropraktik kommt.
Andererseits bietet AK auch eine einfache Möglichkeit zur Diagnostik
von Allergien, Unverträglichkeiten, toxischen Belastungen,
Medikamenten, Organ- und Meridianstörungen, Fehlfunktionen im Mund-/
Kiefergelenksbereich sowie psychischen Störungen.
Wie keine andere Methode ist die AK geeignet, funktionelle
Zusammenhänge zwischen allen diesen körperlichen und geistigen
Bereichen sicht- und spürbar für Patient und Therapeut darzustellen,
nämlich über die Testung der Musku-
latur.
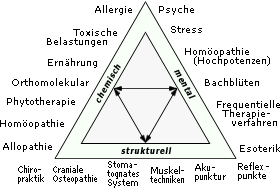 Goodheart
empfiehlt für die ganzheitliche Betrachtung jedes gesundheitlichen
Problems die Sichtweise des ("Dreiecks der Gesundheit" ("Triad of
Health") und beschrieb ursprünglich 5 Systeme, die mit diesen
Störungen zu tun haben können: Goodheart
empfiehlt für die ganzheitliche Betrachtung jedes gesundheitlichen
Problems die Sichtweise des ("Dreiecks der Gesundheit" ("Triad of
Health") und beschrieb ursprünglich 5 Systeme, die mit diesen
Störungen zu tun haben können:
1. Das Nervensystem
2. Das lymphatische System
3. Das vaskuläre System
4. Das craniosacrale System als Regulator und Produktionsstätte des
Liquors
5. Das Meridiansystem (Akupunkturmeridiane)
Aus heutiger Sicht kommen natürlich
noch dazu:
6. Das "System der Grundregulation",
d.h. das von Prof. Pischinger und seinen Mitarbeitern in Wien in den
letzten 40 Jahren beschriebene System aus Bindegewebestrukturen und
Zellen, der Gewebsflüssigkeit und bestimmten Zellen des
Lymphsystems, das entwicklungsgeschichtlich älter und grundlegender
ist als das Nervensystem.
Tatsächlich nimmt man an, daß vor allem das "System der
Grundregulation" der Angriffspunkt der meisten Naturheilverfahren
ist!
7. Psychisch-geistige Zusammenhänge
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
Wichtige Grundprinzipien der AK
1. Der richtige AK-Muskeltest
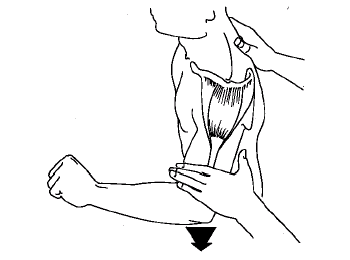 Das
allerwichtigste in der AK ist natürlich ein guter Muskeltest.
Goodheart selbst beschreibt die Testung des M. deltoideus (siehe
Abb.) wie folgt: Das
allerwichtigste in der AK ist natürlich ein guter Muskeltest.
Goodheart selbst beschreibt die Testung des M. deltoideus (siehe
Abb.) wie folgt:
"Ich bitte den Patienten, den Arm
in eine Position von 90° Abduktion ( = vom Körper weg seitlich
hochheben) mit 90° Beugung im Ellenbogen zu bringen. Dann erkläre
ich dem Patienten in möglichst einfachen Worten den Testvorgang, der
daraus besteht, daß der Patient gegen meinen Druck
- so fest er kann - noch weiter in Richtung Abduktion drückt. Mein
Druck gegen den Ellenbogen des Patienten erfolgt mit einem breiten,
weichen Kontakt, bei dem jeder Schmerz vermieden wird.
Der gesamte Muskeltest ist isometrisch
( = ohne Veränderung der Muskellänge); ich fühle, wie der Patient
seine maximale Kraft entwickelt und drücke mit genau gleicher Kraft
dagegen. Hat der Patient seine Maximalkraft erreicht, dann erhöhe
ich meinen Druck fast unmerklich nochmals um ca. 2-4% für eine
Zeitdauer von maximal 1,5-2,5 Sekunden.
Wir nennen den Muskel stark, wenn der Patient dem kleinen Extradruck
widerstehen kann; als ›Schwäche‹ definieren wir, wenn der Patient
diesem Extradruck nicht standhalten kann. Wichtig ist also, daß der
Patient als erstes zu drücken beginnt und daß man nicht die absolute
Muskelstärke in Kilopond testet, sondern die Fähigkeit des
Patienten, eine maximale isometrische Kontraktion gegen meinen
ansteigenden Testdruck auszuführen.
Im Regelfall sollte die eigentliche Testung des Muskels nicht länger
als ca. 2 bis maximal 3Sekunden dauern."
| Grafische Darstellung eines
AK-Tests |
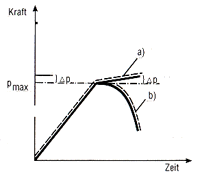 |
| Pmax |
= subjektives Kraftmaximum
des Patienten |
|
= Druck des Patienten |
| ------ |
= Druck des Untersuchers |
 p p |
= 2-3-4% zusätzlicher Druck
des Untersuchers, langsam ansteigend |
| a) |
= der Muskel des Patienten
bleibt stark, d.h. er kann den kleinen Extradruck des
Untersuchers,
 p
richtig beantworten ("locking in") p
richtig beantworten ("locking in") |
| b) |
= plötzliches
"Zusammenbrechen" des Muskels, d.h.
 p
kann nicht richtig beantwortet werden. p
kann nicht richtig beantwortet werden. |
| - Das Erkennen
von Pmax und die
gefühlvolle Testdurchführung ist die Kunst des Untersuchers |
| - Die Reaktion
des Patienten a) oder b) ist der entscheidende Schritt des
AK-Muskeltests! |
|
Versucht man diese Beschreibung des
Muskeltests grafisch zu erfassen, so ergibt sich das nebenstehende
Schaubild.
Entscheidend ist, daß der Patient mit
maximaler Stärke gegen den Widerstand des Untersuchers drückt und
der Untersucher in der Lage ist, langsam und fast kaum merklich noch
einen geringgradig (2-4%) höheren Druck auszuüben.
Keinesfalls sollte der Patient
das Gefühl haben, vom Untersucher "übertölpelt" zu werden!
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
2. Drei mögliche Ergebnisse des
Muskeltests
Bei einem ordnungsgemäß ausgeführten
Muskeltest ergeben sich drei mögliche Testergebnisse.
A. Schwacher Muskel
Der Patient kann den Testmuskel nicht ausreichend stark anspannen
(kontrahieren).
B. Normotoner Muskel:
Der Muskel kann dem ansteigenden Testdruck des Untersuchers
ausreichend Widerstand leisten, reagiert aber auf normalerweise
schwächende (sedierende) Maßnahmen mit einer vorübergehenden
Schwächung (s. u.)
C. Hypertoner Muskel:
Der Muskel des Patienten ist stark wie unter B., reagiert aber auf
normalerweise schwächende bzw. sedierende Maßnahmen nicht, bleibt
also mit anderen Worten immer stark (und eben damit zu stark).
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
3. Das Stresskonzept nach Selye
Wer wirklich ernsthaft mit AK
arbeitet, hat damit ein ideales Untersuchungsinstrument, um mit dem
Patienten alle wesentlichen negativen Faktoren (Distress)
herauszufinden und, wo möglich, zu beseitigen und damit dem
Patienten möglichst viel Eustress zu ermöglichen.
Um den AK-Untersuchungsgang zu verstehen, ist ein gewisses
Grundwissen über das Stresskonzept von Selye notwendig. Selye, in
Ungarn geboren und dann nach Kanada ausgewandert, definierte als
Ergebnis jahrzehntelanger Versuche Stress wie folgt:
"Stress ist die Summe aller Adaptationsvorgänge und Reaktionen
körperlicher wie psychischer Art, mit denen ein Lebewesen auf seine
Umwelt und die von innen und außen kommenden Anforderungen
reagiert."
Diese Definition muß man sehr genau
lesen. Sie bedeutet nämlich auch:
- Kein Leben ohne Stress
- Ohne Stress kein Leben
Obwohl Selye dies von Anfang an immer sehr genau gesagt hatte, wurde
er doch - zum Teil auch heute noch - mißverstanden. Er prägte
deshalb zwei weitere Begriffe:
Eustress und Distress
Sie bezeichnen im Prinzip die beiden Polaritäten, die, wie überall
im Leben, auch im Wort Stress enthalten sind; nämlich Eustress als
das, was wir wirklich gerne machen, was uns guttut, und im Gegensatz
Distress als das, was wir nicht gerne tun, was schlecht für uns ist,
was wir gezwungenermaßen tun usw.
Vereinfacht gesagt sollte unser Ziel
sein, möglichst viel Eustress und möglichst wenig Distress zu haben.
Selye selbst gab unter anderem folgende Tips:
- Lerne zwischen deinem eigenen
Eustress und Distress zu unterscheiden.
- Analysiere deine Probleme genau.
- Überanstrenge und verkrampfe dich
nicht, sondern lerne dein eigenes Ruhebedürfnis kennen und folge
ihm.
- Herdsanierung: Auch Selye wies
bereits darauf hin, daß Herde einen ständigen Distress für den
Körper bedeuten, auch wenn keine Symptome bestehen.
- Vermeide einseitige Belastungen.
Der Körper will gerne Stress auf einem Gebiet (Bsp. körperlich
harte Arbeit) durch Stress auf anderem Gebiet (Bsp. Lesen,
Musizieren) ausgleichen.
- Bei zuviel Gesamtstress muß man
Ruhen!
Selye fand im Verlauf
jahrzehntelanger Versuche mit Labortieren heraus, daß es, egal mit
welcher Methode, möglich war, letztlich alle Tiere zu Tode zu
stressen und daß dabei immer die gleichen Organe in gleicher Weise
verändert waren:
- Magen: Entzündungen,
Geschwüre, Durchbrüche
- Thymus: atrophiert (=
verkleinert und in der Funktion eingeschränkt)
- Nebennieren: verfettet und
in der Funktion eingeschränkt.
Andere Organe waren je nach Belastung
ebenfalls verändert, doch die drei oben genannten fanden sich immer!
Wird ein lebender Organismus einem Stress ausgesetzt, kommt es
zuerst zu einer Alarmreaktion (A. R.): Für eine kurze Zeitphase
fällt die Leistungsphase ab,
um dann schnell als Reaktion steil anzusteigen.
Besteht der Stress für längere Zeit oder wird er häufig wiederholt,
kommt es zum Stadium der Resistenz (S.R.) als Zustand einer
maximalen Adaption.
Dies ist eine sinnvolle Reaktion, da der Organismus so sehr
leistungsfähig ist und auch über längere Zeit bleiben kann.
Wirkt der Stress aber zu lange ein, so kommt es zum Stadium der
Erschöpfung (S. E.), aus dem eine Rückführung ins Stadium der
Resistenz nur schwer möglich ist; auf jeden Fall bedarf es einer
längeren Ruhephase und möglichst umfassender therapeutischer
Anstrengungen samt einer Änderung der Lebensführung des Patienten.
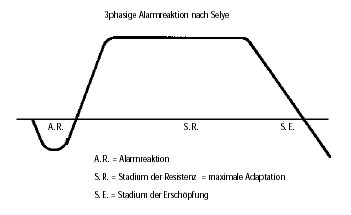 Stress-assoziierte
Probleme Stress-assoziierte
Probleme
- rezidivierende Infekte
- Allergien und Heuschnupfen
- Magen- und sonstige
Verdauungssymptome
- Schlafstörungen, Gereiztheit,
ständige Unlust und sonstige nicht üblichen psychischen Symptome
- Konzentrationsschwäche,
Gedankenflucht
- ständige Müdigkeit, depressive
Verstimmung
- Zittern, nervöse Ticks, Stottern
- nächtliches Knirschen der Zähne
mit den Folgen: erhöhte Empfindlichkeit bzw. Schmerzen gegen
süß/sauer, heiß/kalt, evtl. Kiefergelenksprobleme
- häufiger Harndrang
- Migräne, prämenstruelles Syndrom
- Nacken- und Kreuzschmerz ( "Mir
sitzt die Angst im Nacken")
- zu wenig oder zu viel Appetit
- verstärkter Bedarf an Nikotin,
Alkohol, Kaffee, sonstigen Drogen
- ständige kleinere Verletzungen
oder auch chronische "Wehwehchen", die trotz guter Therapie nicht
auszuheilen sind.
Die drei möglichen Muskelreaktionen
schwach - normoton - hyperton kann man mit Selye's Konzept
erklären:
Normotonus: Der Normotonus entspricht einer relativ
zufriedenstellenden Reaktionslage, denn offensichtlich kann der
Körper sowohl potentiell negative als auch positive Reize erkennen
und über den Muskeltest entsprechend beantworten.
In diese Kategorie gehören auch isolierte Muskelschwächen, die aus
verschiedensten Gründen auftreten können, und die sich ja meist
durch eine ganze Reihe von therapeutischen Maßnahmen beheben lassen.
Hypertonus: Hierbei - vor
allem, wenn praktisch alle Muskeln hyperton sind - handelt es sich
um eine übergroße Anspannung des gesamten Organismus und damit auch
der Muskulatur, die in den meisten Fällen durch einen langen,
andauernden und großen Stress, egal welcher Herkunft bedingt ist.
Hier wäre nach Selye primär wichtig, daß der Patient sich ausruht;
für die naturheilkundliche Therapie bedeutet es auch noch alle
sinnvollen Hilfsmaßnahmen zu ergreifen, um den Patienten von
möglichst vielen Seiten her zu entlasten. Man muß also den Körper
entgiften, den Darm sanieren, die Allergene vermeiden, Herde (wie z.
B. tote Zähne, vereiterte Mandeln) sanieren, für bessere Bewegung an
frischer Luft sorgen und vieles andere mehr. Gleichzeitig sollten
auch die wichtigsten psychischen Belastungsfaktoren angegangen
werden und möglichst alle fehlenden Substanzen aus der
Orthomolekularen Medizin (Vitamine, Mineralien, Spurenelemente,
Enzyme u.s.w.) möglichst schnell und wirkungsvoll ersetzt werden.
Generelle Schwäche: Die
nächste Stufe ist dann das Erschöpfungsstadium nach Selye; in der
AK-Testung entspricht das dem Patienten, bei dem alle oder fast alle
Muskeln schwach sind, und bei dem es häufig sehr schwer ist,
überhaupt einen einzigen Muskel reflexmäßig zu stärken. Die bereits
unter Hypertonus genannten Maßnahmen sind hier ebenfalls von
entscheidender Bedeutung, müssen aber häufig noch vorsichtiger und
gleichzeitig intensiver angewandt werden. Wichtig ist auch, dem
Patienten positive Energie, Ruhe, Wärme und auch geistig-emotionale
Hilfe zu geben.
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
4. Die beiden wichtigsten
Diagnosemethoden der AK: TL und Challenge
Während in der frühen Geschichte der
Applied Kinesiology das "Trial and Error " Prinzip ("Versuch und
Irrtum") notwendig war, um die notwendige therapeutische Methode zu
finden, fand Dr.Goodheart bald zwei Methoden zur Verbesserung der
AK-Diagnose:
Therapielokalisation und Challenge
Therapielokalisation (TL)
Obwohl das Phänomen der TL noch nicht
vollständig erklärt ist, weiß man, wie es in der AK-Untersuchung
funktioniert:
Wenn ein Patient eine Körperregion berührt und eine Änderung der
Muskelstärke auftritt, bezeichnen wir dies als positive TL.
Therapielokalisation sagt uns, wo eine Störung liegt, aber nicht,
welcher Art diese Störung ist.
Beispiele:
•Positive TL einer Wirbelsäulenregion indiziert weitere Untersuchung
durch Palpation und funktionelle Analyse. Wenn eine Subluxation
(Blockierung) oder Fixation gefunden und kunstgerecht korrigiert
wird, dann sollte die positive TL verschwinden.
•Positive TL an einer Operationsnarbe
zeigt eine Störung in diesem Bereich an. Diese kann einerseits von
der Narbe selbst ausgehen oder von irgendeiner der darunterliegenden
Strukturen und Organe. In diesem Fall sollte man damit beginnen, die
Narbe mit einer oder mehreren Behandlungsmethoden wie Laser,
Neuraltherapie, Eis, Massage, etc. zu behandeln, und dann erneut
testen. Sollte die positive TL persistieren, dann muß eine
gründlichere Untersuchung der Organe erfolgen.
Challenge
Wenn der Patient einem Testreiz
ausgesetzt wird und die Muskelstärke sich ändert, dann spricht man
von einem positiven Challenge. Wie bei der TL kann die
Stärkeänderung von stark nach schwach und von schwach nach stark
erfolgen.
Es gibt fünf mögliche Reaktionen auf
einen Challenge:
Challenge
a) kann einen normotonen oder hypertonen Muskel schwächen
b) kann einen schwachen Muskel stärken
c) kann die Stärke eines starken oder schwachen Muskels nicht ändern
d) ein schwacher oder normotoner Muskel wird hyperton
e) ein hypertoner Muskel wird normoton
Fall a):
Der Körper erkennt den Challenge als einen Stress, der groß und
spezifisch genug ist, um mit einer neuromuskulären Inhibition (=
"Abschaltung des Muskels") zu reagieren.
Fall b):
Der Körper erkennt den Challenge als spezifisch genug, eine
bestehende neuromuskuläre Inhibition zu korrigieren, was zur
Muskelstärkung führt.
Fall c):
Der Challenge mag potentiell bedeutsam sein, aber der Körper
reagiert zu diesem Zeitpunkt nicht auf den Reiz.
Fall d):
Der Challenge stellt für den Körper offenbar einen sehr großen
Stress dar, auf den er mit einer maximalen Reaktion, dem Hypertonus,
als Alarmzeichen reagiert.
Fall e):
Der Challenge - meist Heilmittel - ist energetisch optimal und
offenbar für den Patienten wichtig, denn er ist in der Lage, ihn aus
der Überanspannung der Alarmreaktion herauszuführen.
Tatsächlich ist der Challenge zur
Grundlage jeder gründlichen AK-Untersuchung geworden.
Beispiel A
- An der Wirbelsäule, Schädel, Becken und allen anderen
Gewebestrukturen liefert der Challenge den exakten Korrekturvektor
(= Richtung für die manuelle Behandlung) und, wenn nötig, die
Atemphase, die eine weiche, mobilisierende Technik unterstützt.
Beispiel B
- Oraler oder nasaler Challenge deckt Nahrungsmittelintoleranzen,
für den Körper unverträgliche und toxische Substanzen, Allergien,
etc. auf, wenn ein vorher normotoner Muskel auf Inhalation oder
Ingestion der Substanz schwach oder hyperton wird [Fälle a) und d)].
Beispiel C
- Wenn ein Muskel auf eine orthomolekulare Substanz normoton wird,
kann man annehmen, daß diese Substanz dem Patienten derzeit helfen
würde [Fälle b) und e)]. Das bedeutet nicht unbedingt, daß der
Patient einen Mangel an dieser (Nährstoff)-Substanz hat, sondern
sollte zu einer genaueren Untersuchung hinführen, die Anamnese,
körperliche Untersuchung und Labor zusammenwirkend beinhaltet.
Beispiel D
- Wenn ein schwacher Muskel auf ein homöopathisches Mittel,
phytotherapeutikum oder allopathisches Mittel normoton wird [Fälle
b) und e)], dann würden wir unter Umständen dieses Mittel
verschreiben. Auch hier sollten andere diagnostische Kriterien
erfüllt werden und die Heilmittel sollten entsprechend
Arzneimittelbild, Pathophysiologie und Wirkspezifik verordnet
werden.
Beispiel E
- Wenn das Denken an ein Problem oder die Exposition gegenüber einer
psychologisch belastenden Situation den Muskel schwächt oder
hyperton macht, dann spricht man von einem positiven psychologischen
Challenge, der weitere Untersuchung und entsprechende Behandlung
erfordern würde.
Sehr frühzeitig in der Entwicklung
der AK wurde deutlich, daß gewisse Muskeln eng mit spezifischen
Organen verbunden sind: Dr. Goodheart bezeichnete diese
Muskel/Organ/Meridian-Assoziation als Teil der "Body Language".
Klassischerweise kann eine Organstörung zu Muskelschwäche führen.
Wenn man die Körperregionen und adaptiven Mechanismen des Körpers
betrachtet, kann man drei Arten von Reaktionen unterscheiden:
Bei einer Organstörung testen der
oder die mit dem Organ assoziierten Muskeln entweder
a) schwach
b) normal
c) hyperton
Die Fälle b) und c) sind diejenigen,
die problematisch sein können, wenn der Muskeltest nicht mit dem
nötigen Können durchgeführt wird. Wenn jedoch ein sorgfältiger
AK-Test und andere anerkannte diagnostische Methoden verwendet
werden, dann gibt es beinahe immer eine natürliche Erklärung:
für b):
Der Körper hat sich u. U. voll an die Dysfunktion angepaßt und mag
nur eine Schwäche in einem oder mehreren für die Adaptation
notwendigen Regelkreisen zeigen oder überhaupt keine Schwäche
- oder -
Der Körper kann aufgrund von Neurologischer Dysorganisation,
Psychological Reversal (= "Psychologische Umkehrung") o.ä., unfähig
sein, Schwäche zu zeigen.
für c):
Hyperton bedeutet in der AK "nicht schwach werden auf einen
physiologisch schwächenden Reiz ". Ein einfacher Grund kann sein,
daß das Regulationssystem Energie in den gestörten Regelkreislauf
zieht.
Genereller Hypertonus entsteht in der Regel auf langanhaltenden
starken Stress jeglicher Art.
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
AK-Testung bei Allergien, Unverträglichkeiten und sonstigen
Überempfindlichkeitsreaktionen
Wie aus dem bisher Gesagten
hervorgeht - siehe vorne auch Beispiel B -, ist die AK natürlich
auch dazu geeignet, auf ideal einfache Art und Weise alle für den
Körper negativen bzw. unverträglichen Substanzen erkennen zu helfen.
Nochmals das Grundprinzip: Wird
durch den Kontakt mit irgendeiner Substanz ein starker Muskel
schwach oder eine normotoner Muskel hyperton, dann werten wir dies
als Unverträglichkeitsreaktion des Körpers eben auf diese Substanz.
Da wir - im Gegensatz zu den meisten
schulmedizinischen Diagnoseverfahren - die zu testenden Substanzen
mit der Schleimhaut des Patienten in Kontakt bringen (Mund
oder Nase) erhalten wir mit der AK-Testung mehr und bessere Hinweise
auf gewisse Allergie- und Unverträglichkeitsphänomene als die
herkömmlichen Allergietestverfahren.
So gelingt es immer wieder,
Substanzen als unverträglich zu finden, die der Patient teilweise
seit Jahrzehnten ohne jegliches subjektives Mißempfinden zu sich
nimmt. Es ist einleuchtend, daß sich alleine schon durch Weglassen
dieser Substanzen häufig auch chronische und schwerste
Allergiezustände bessern lassen.
Kommt dann noch eine sinnvoll angewandte orthomolekulare Therapie,
eine gute homöopathische Behandlung und/oder weitere notwendige
naturheilkundliche Korrekturmaßnahmen dazu, so läßt sich eine
dauerhafte Besserung und wirkliche Stabilisierung des
Gesundheitszustandes erreichen. Häufig können dann nach einer
gewissen Zeit durchaus vorher unverträgliche Substanzen wieder
vertragen werden, insbesondere, wenn darauf geachtet wird, diese
nicht täglich, sondern nur jeden 4. oder 5. Tag zu essen oder zu
trinken.
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
AK bei der Behandlung von
Lernstörungen, Legasthenie, Hyperaktivität und anderen funktionellen
geistigen und koordinativen Störungen
Mit AK läßt sich bei einer Vielzahl
von Störungen, die auf falscher Koordination bzw. gestörter
Verarbeitung von geistigen und körperlichen Impulsen beruhen,
teilweise verblüffend einfach und erfolgreich Hilfe leisten.
Untersucht wird im Prinzip, welche
geistige, körperliche oder musische Funktion die Muskelstärke im
AK-Test ändert und je nach Ergebnis wird dann mit einer Vielzahl von
Maßnahmen wie craniosacraler Therapie, Reflexpunktbehandlungen,
gezielter Übungsbehandlung, orthomolekularer Therapie (siehe unten),
gezielter Stimulation (Farben, Töne, Frequenzen usw.), Homöopathie
und Bach-Blüten versucht, möglichst kausal die zugrundeliegenden
Blockaden und Störungen zu beseitigen.
Die AK und verschiedene von ihr
abgeleitete Verfahren wie "Kinesiologie", "Touch for Health",
"Edu-Kinesiologie" usw., zeigen so vielversprechende Ergebnisse, daß
hier für die Zukunft vielleicht das breiteste Anwendungsgebiet
liegt!
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
AK in der Orthomolekularen Medizin
Ein besonders interessantes
Anwendungsgebiet in der AK ist die Testung orthomolekularer
Substanzen, d.h. Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, Enzyme,
Aminosäuren usw.
Ein Problem der orthomolekularen
Medizin in der Praxis ist nämlich, daß häufig für die einzelnen
Substanzen keine gesicherten Normwertbereiche existieren, die
Messungen häufig zeitaufwendig und teuer sind, gemäß der
Symptomatologie des Patienten eine Vielzahl von Substanzen
potentiell in Frage kommen und durch all diese Faktoren häufig nicht
hundertprozentig sicher ist, was therapeutisch eingesetzt werden
soll. Nun ist es so, daß natürlich auch die AK keine
hundertprozentige Sicherheit bietet. Allerdings bietet sie
zusätzlich zu den normalen orthomolekularen Untersuchungsmethoden
einen unschätzbaren Vorteil: Sie ermöglicht es, sofort die Reaktion
des Körpers auf eine in Frage kommende Substanz zu testen!
Weitere wichtige Vorteile der AK im
Bereich der orthomolekularen Medizin sind:
- Identifizierung unverträglicher Medikamentenzubereitungen
Dies ist ein Problembereich bei
Patienten mit Allergien bzw. Unverträglichkeiten, klinisch
ökologischen Krankheiten, Intoxikationssyndromen u.a..
Häufig ist es nämlich so, daß der Patient die vom Arzt gedachte
orthomolekulare Substanz braucht, aber eben nicht in der
Zubereitungsform, in der er sie erhält. Vor allen Dingen bei
Tabletten und Dragees darf nämlich die pharmazeutische Industrie den
eigentlichen Wirksubstanzen eine Vielzahl von Begleitstoffen
beimengen, ohne diese für den Patienten genau ersichtlich angeben zu
müssen. Bei guter Testung mit AK könnte in so einem Fall zum
Beispiel folgendes auftreten: Ein schwacher Testmuskel (z.B.
Deltoideus) wird durch eine Vitamin C-Tablette zuerst stark, dann
aber, nachdem die Tablette weitere 25-30 sec. im Mund belassen wird,
wieder schwach - und nicht nur er, sondern auch alle übrigen
Muskeln. Dies erklären wir in der AK so, daß der Körper offenbar
zuerst über sein orales Rezeptorsystem die therapeutisch wichtige
Substanz (Vitamin C) erkennt, was zur Stärkung des schwachen Muskels
führt.
Dann aber registriert der Körper auch die übrigen in der Tablette
enthaltenen Substanzen: Beispielsweise könnten dies Lactose,
Magnesiumstearat, Macrogol 6000, Talkum, Calciumcarbonat,
Methacrylsäure Copolymerisat, Typ A, Polyvidon, Dibutylphthalat,
gelbes Wachs, Carnaubawachs, Farbstoffe E110, E124, Geruchsstoffe
(Zusatzstoffe eines bekannten deutschen Enzympräparates) sein.
Welcher verantwortungsbewußte
Therapeut wird nun dem Patienten diese Dragees verschreiben?
- Mitarbeit des Patienten
(Compliance)
Im Gegensatz zu allen anderen
Diagnoseformen geben wir in der AK therapeu-
tisch eine Substanz, die für den Patienten sicht- und vor allen
Dingen fühlbar eine Schwäche positiv beeinflußt hat.
Die Patienten werden deshalb die so gefundenen Therapeutika sicher
bereitwilliger und konsequenter einnehmen, als wenn diese nur nach
einem kurzen therapeutischen Gespräch oder Laboruntersuchungen
verordnet worden wären.
Umgekehrt werden unverträgliche
Substanzen eher gemieden, wenn die negative Auswirkung körperlich
erfahren wird. Dies ist v.a. bei Kindern wichtig!
- Aufdeckung von antagonistisch
wirksamen Substanzen und ihre Wirkung auf den Körper. Die meisten in
der orthomolekularen Medizin eingesetzten Substanzen haben teilweise
auch antagonistische Beziehungen zueinander.
Was heißt das?
Viele wissen, daß z. B. Kalzium und Magnesium in gewisser Weise
Gegenspieler sind. Tatsächlich ist es so, daß zwischen allen
Mineralstoffen und Spurenelementen gewisse synergistische (d. h.
sich gegenseitig unterstützende) und auch antagonistische
(gegeneinander wirkende) Beziehungen bestehen. Einige der für den
klinischen Alltag häufigsten antagonistischen Beziehungen seien kurz
aufgeführt:
Eisen - Kupfer
Zink - Kupfer u.v.m.
Da jeder Patient individuell zu sehen ist und andererseits ein
gewisser Patient durchaus gleichzeitig an einem Mangel an Kupfer,
Eisen und Zink leiden kann, ergibt sich in der Praxis häufig die
Frage, wie, wann und wie oft die fehlenden Substanzen gegeben werden
sollen.
Die AK kann hier helfen: Hat z.B. ein Patient von der insgesamt als
äußerst positiv zu beurteilenden Substanz Zink derzeit eher
zuviel zur Verfügung, so würde ein starker Testmuskel durch die
orale Gabe von etwas Zink schwach werden. Die durch Zink erzielte
Schwäche könnte dann z.B. durch Kupfer, aber auch Eisen ausgeglichen
werden. Vor allem bei sehr empfindlichen Patienten ist es so
möglich, die Therapie durchaus sogar jede Woche der veränderten
Reaktionslage des Patienten anzupassen.
- Spürbare Zusammenhänge zwischen
Schmerzzuständen, anscheinend
orthopädischen Beschwerden und orthomolekularen Heilmitteln
Eine der faszinierendsten
Möglichkeiten der AK ist die Verwendung orthomolekularer
Reinsubstanzen bei Schmerzsyndromen. Es hat sich nämlich gezeigt,
daß in den meisten Fällen akut oder chronisch schmerzhafte Muskeln
im AK-Test sofort mit einer Stärkung und weitgehenden
Schmerzfreiheit reagieren, wenn eine der vom Körper am dringendsten
benötigten Substanzen auf die Zunge gegeben wird. Der Körper scheint
regelrecht zu erkennen, was ihm fehlt, und scheint sich dann damit
zu "bedanken", daß die vorher häufig so schmerzhafte Anspannung des
Muskels nun schmerzfrei und ungehindert möglich ist. Die genauen
Wirkmechanismen dieses Vorgangs verstehen wir derzeit noch nicht;
sicher wird die Forschung hierfür eine rationale Erklärung liefern
können. Das Phänomen erscheint geradezu unglaublich, ist aber für
den Patienten immer wieder äußerst eindrucksvoll und bringt ihn dann
natürlich dazu, die getesteten Substanzen brav und regelmäßig zu
nehmen. Dem Arzt und Untersucher zeigt die plötzliche
Schmerzfreiheit durch die Gabe der richtigen orthomolekularen
Substanz(en), wo "der Hase im Pfeffer liegt".
Häufig lassen sich so viele oft lange Zeit nicht erfolgreich
behandelbare Schmerzsyndrome und sogar wirkliche rheumatische
Erkrankungen erfolgreich behandeln.
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
AK in der Manuellen Medizin
Die AK hat viele Techniken aus der
Chiropraktik und der Osteopathie integriert und ist dadurch
besonders auch für die Manuelle Medizin wichtig.
Da sich durch den Muskeltest viele Faktoren untersuchen lassen, die
ursächlich für muskuläre und damit strukturelle Dysbalancen sind,
kann die AK gerade auch bei anscheinend therapieresistenten
orthopädischen Problemen erfolgreich eingesetzt werden. AK hilft
a) die zu behandelnde(n) Stelle(n) zu finden
b) die Art und Weise der Korrektur zu bestimmen
c) zu untersuchen, ob die Korrektur effektiv war
d) herauszufinden, ob die Korrektur "hält", d.h. von Dauer ist.
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
AK in der Zahnmedizin und
Kieferorthopädie
Wie keine andere Methode kann die AK
bei den drei wichtigsten Problembereichen dieser Fachgebiete helfen:
- Das Materialproblem
Eventuell störende Materialien wie Amalgam, Gold- und
Stahllegierungen sowie andere dentale Werkstoffe und ihre
Auswirkungen auf den Rest des Körpers können untersucht werden.
- Das Herdproblem
Verdächtige ("störende") Zähne, aber auch Kieferbereiche ohne Zähne
können leicht identifiziert und auf ihre "Wertigkeit" für den
Gesamtorganismus untersucht werden.
- Kiefergelenksstörungen
("Craniomandibuläre Dysfunktion")
Mechanische Störungen durch falsche Unterkieferposition,
blockierende kieferorthopädische Apparate und Fehlkontakte einzelner
Zähne sind häufig das entscheidende Hindernis zur Heilung bei
Tinnitus, Schwindel und anderen Innenohrstörungen, Kopfschmerzen
(v.a. auch bei Kindern), Legasthenie, Hyperaktivität, chronischen
Schmerzen am Bewegungsapparat und vielen anderen Problemen.
Die AK-Untersuchung kann die Zusammenhänge aufdecken und dabei
helfen, die notwendigen Korrekturen optimal durchzuführen.
Achtung: Das Ergebnis des
Muskeltests ist nicht ausreichend für eine ordnungsgemäße Diagnose;
vielmehr sind hierzu auch möglichst viele andere klinische Verfahren
heranzuziehen. Obwohl Goodheart selbst dies von Beginn an immer
wieder erwähnt hat und auch heute noch seine Befunde mit klassischen
klinischen Untersuchungsverfahren belegt, gibt es leider viele
Nachahmer, speziell aus der sogenannten Touch for Health-Bewegung,
die dies nicht machen wollen oder können.
So wird insbesondere häufig das Ergebnis des Muskeltests direkt mit
der Organfunktion korreliert. (Beispiel: Schwacher Teres Minor
'Störung der Schilddrüse).
Wer ausschließlich so arbeitet, hat die
AK in Wirklichkeit nicht verstanden und wendet sie eindeutig nicht
gemäß den von ICAK (International College of
Applied Kinesiology) aufgestellten Kriterien an.
Patientenbeispiele
a. Bei einer Patientin mit einem Schulter-Arm- Syndrom rechts
ist der M. deltoideus schwach und schmerzhaft, wird allerdings
sofort stark und schmerzfrei, wenn die Patientin die Dornfortsätze
der mittleren Halswirbelsäule berührt (Positive TL!). Therapeutisch
wird deshalb nach entsprechender weiterer Untersuchung die
Halswirbelsäule in dem berührten Bereich manualtherapeutisch
behandelt; nach erfolgreicher Therapie ist der Deltoideus
schmerzfrei, stark, und die Schmerzen im Schulter-Arm- Bereich
verschwinden völlig nach zwei weiteren Behandlungen.
b. Eine Mutter kommt mit ihrem
9jährigen Sohn in die Praxis mit der Diagnose Hyperaktivität. Bei
der Untersuchung des Jungen stellt sich heraus, daß mehrere starke
Testmuskeln jeweils total schwach werden, wenn er irgendein
Kuhmilchprodukt in den Mund nimmt. Diagnose: Unverträglichkeit von
Kuhmilchprodukten, die deshalb ab sofort streng zu meiden sind.
Innerhalb kurzer Zeit auffällige Normalisierung des Verhaltens.
Interessant an diesem Fall ist, daß vorher durchgeführte
schulmedizinische Allergietests keinerlei Befunde erbrachten!
c. Eine 42jährige Patientin
kommt mit folgenden Beschwerden: Chronische Verspannungen im
Schulter/Nackenbereich, Durchfälle wechselnd mit Verstopfung, bei
der schulmedizinischen Untersuchung sei nichts gefunden worden.
Aufgrund der weiteren Krankengeschichte und der AK-Untersuchung wird
folgender Test ausgeführt: Man läßt die Patientin an das denken, was
sie am meisten belastet, ohne daß sie darüber spricht. Hierdurch
werden alle starken Testmuskeln schwach (positiver emotionaler
Challenge!). Die Schlußfolgerung ist eindeutig, allerdings will die
Patientin nicht über ihre Probleme sprechen. Sie erhält deshalb eine
Kurzbeschreibung der Bachblüten, um die ihrer Meinung nach passenden
in einer Vorauswahl zu bestimmen. Jeweils ein Fläschchen der so
gefundenen Blüten wird dann der Patientin in die Hand gegeben. Von
den in der Vorauswahl gefundenen 9 Fläschchen führen 4 zu dem
Ergebnis, daß trotz Denken an das Problem alle Muskeln stark
bleiben. Diese 4 Bachblüten werden als Mischung verordnet. Drei Tage
später ruft die Patientin an, daß es ihr deutlich besser ginge und
fragt, ob es noch andere Methoden gäbe, um positiv auf die
Zusammenhänge zwischen Geist und Körper einzuwirken. Eine deshalb
anschließende Feldenkrais-Therapie bringt dann nach einigen Wochen
völlige Beschwerdefreiheit.
d. Eine Patientin mit
rezidivierenden Infekten und chronischen Schmerzen im
Arm-Schulterbereich links kommt zur erstmaligen Untersuchung. Extrem
schwach werden gefunden: M. deltoideus und Serratus anterior. Beide
reagieren mit sofortiger Schmerzfreiheit und Stärkung auf die orale
Gabe von etwas Vitamin C. Nachdem der Mund ausgespült ist, wird nun
noch ein immunstimulierendes Mittel (in diesem Fall Pascotox ®)
gefunden, das ebenfalls beide Muskeln sofort stärkt. Eine
entsprechende, über mehrere Wochen durchgeführte Therapie bringt
innerhalb von drei Wochen völlige Beschwerdefreiheit, obwohl vorher
monatelang orthopädisch und krankengymnastisch ohne Erfolg
therapiert worden war und auch die Infekte mit den verschiedensten
Mitteln bekämpft worden waren.
e. Ein junger Mann hat seit
Jahren Schmerzen im Bereich Schulter und Schulterblatt rechts;
angeblich "psychosomatisch". Die AK-Untersuchung zeigt, daß eine
Störung im linken oberen Trapeziusmuskel den rechten oberen
Trapeziusmuskel schwächt, aber nur unmittelbar nach Kontraktion des
linken Trapezius ("Reaktiver Muskel"). Hierdurch wiederum wird der
rechte Levator Scapulae, ein Synergist ("Helfer ") des oberen
Trapezius, in spezifischer Weise irritiert
("Strain-Counter-Strain"). Durch die so verursachte Schwäche zweier
Muskeln oberhalb des Schulterblattes kam es zu einer
Über-Kontraktion der Muskeln unterhalb des Schulterblattes und der
vorderen Brustmuskulatur rechts ("Muscle Stretch Reaction"). Alle
diese Störungen können in einer Behandlung erkannt und therapiert
werden, wodurch das chronische Beschwerdebild vollständig
verschwindet.
f. Eine junge Frau mit ständig
wiederkehrenden Harnwegsinfekten zeigt eine positive TL an zwei
Schneidezähnen, die energetisch mit Niere / Blase zusammenhängen.
Die weitere zahnärztliche Untersuchung zeigt einen Eiterherd an
einem Zahn, eine Wurzelfüllung mit Amalgam am anderen. Nach
Extraktion und chirurgischer Sanierung des wurzelgefüllten Zahns
geht es bereits deutlich besser. Nach Entfernung der übrigen
Amalgamfüllungen und entsprechender Ausleitung erfolgt die
kieferchirurgische Sanierung des eitrigen Frontzahnes. Danach
völlige Beschwerdefreiheit!
g.
Ein 12jähriges Mädchen mit relativ gut kompensierter Legasthenie
wird plötzlich in der Schule schlechter und klagt zunehmend über
diffuse Kopfschmerzen. Bei genauer Nachfrage ergibt sich, daß kurz
vorher eine kieferorthopädische Behandlung ("Mulitband") begonnen
wurde. Im AK-Test werden durch festen Biß - also einen mechanischen
Challenge - mehrere starke Testmuskeln schwach. Die Schwäche läßt
sich durch keinerlei andere Maßnahme, wie Einlegen von
Papierstreifen oder Watteröllchen, beheben. Deshalb wird der Familie
die vollständige Entfernung empfohlen. Danach gibt das Mädchen
innerhalb von Stunden an, sich "frei zu fühlen"; die Kopfschmerzen
sind verschwunden. Die weitere Versorgung erfolgt in diesem Fall
durch einen ebenfalls mit AK-Testung optimierten
kieferorthopädischen Apparat nach Prof. Balters ("Bionator").
Interessanterweise bessern sich hierdurch die schulischen Leistungen
so deutlich, daß nach einigen Wochen die Lehrer bei der Familie
anfragen!
 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
|